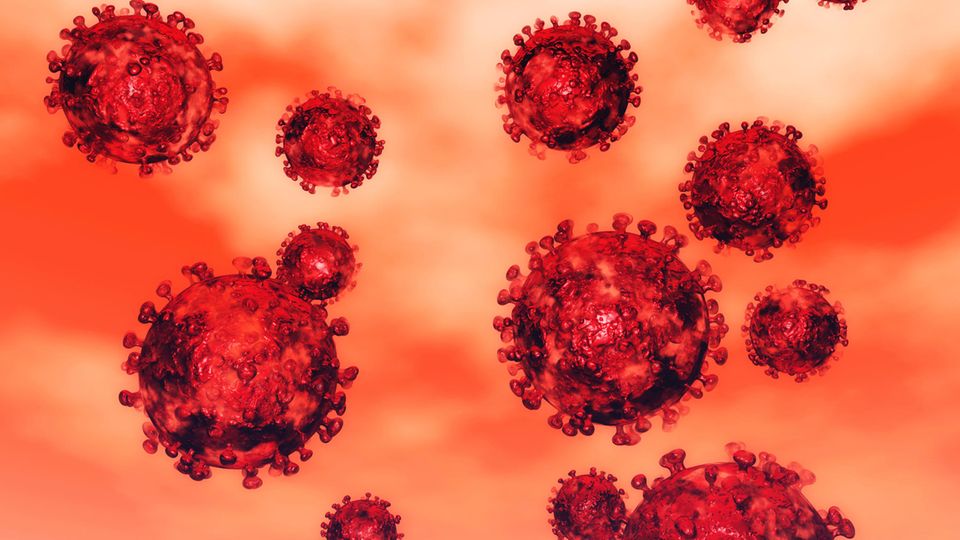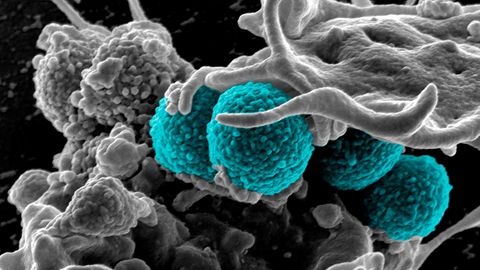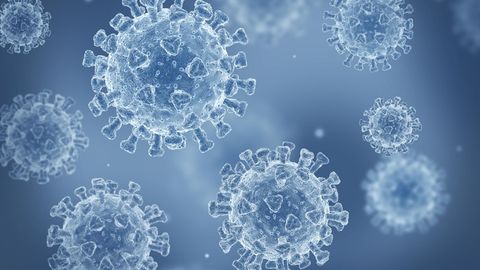Tests auf das Coronavirus helfen, Infektionsketten zu durchbrechen und können Leben retten. Für US-Präsident Donald Trump sind sie dagegen: ein willkommener Sündenbock. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen in den USA war der Schuldige schnell gefunden: "Weil wir mehr testen, haben wir mehr Fälle", spielte er jüngst die Situation herunter. "Wenn wir die Hälfte der Tests machen würden, hätten wir viel weniger Fälle." Die USA zählen aktuell zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Mehr als drei Millionen US-Amerikaner haben sich bereits nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.
Mehr Tests führen zu mehr bestätigten Infektionsfällen - in diesem Punkt hat Trump Recht. Ein Land, das beispielsweise keine Tests durchführt, könnte daher auch niemals mit hohen Infektionszahlen auffallen. Dennoch ist die Logik des US-Präsidenten bestechend eindimensional. Tatsächlich zählen Tests auf das Coronavirus zu den wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie: Wird viel getestet, sinkt die Dunkelziffer. Lokale Ausbrüche und Infektionsketten können schnell unter Kontrolle gebracht, Kontaktpersonen ermittelt und in Quarantäne geschickt werden. Wer viel testet, kann steuern - vorausgesetzt, der politische Wille dazu ist da. Wer nicht testet, kann Ausbrüche nur über sich ergehen lassen - und nimmt damit billigend Kranke und Tote in Kauf.
Zwei gängige Testmethoden gibt es: eine Variante, die auf das Virus selbst und sein genetisches Material abzielt, der sogenannte PCR-Test. Der Test schlägt selbst bei kleinsten Virusmengen an, da das genetische Material während des Testverfahrens vervielfältigt wird.
Bei der zweiten Methode, dem Nachweis via Antikörper aus dem Blut, kann die Krankheit dagegen bereits überstanden sein. Ein positives Testergebnis gibt lediglich Aufschluss darüber, dass die Person in der Vergangenheit mit dem Erreger in Kontakt gekommen ist. In Deutschland besitzt etwa Pharma-Riese Roche eine Genehmigung für einen solchen Test. Er kann nach Angaben des Herstellers zum Beispiel für Beschäftigte im Gesundheitswesen sinnvoll sein und lässt Rückschlüsse auf Arbeitskräfte zu, die bereits eine gewisse Immunität gegenüber Sars-CoV-2 entwickelt haben.
Testmethoden für direkten Virennachweis
Viele kommerzielle Firmen versuchen derzeit allerdings, Testmethoden für einen direkten Virennachweis zu entwickeln oder zu optimieren. Denn anders als beim Antikörper-Test können damit auch aktive Infektionen erfasst werden. Und tatsächlich gibt es auf dem Gebiet noch Optimierungsbedarf.
Ein Nachteil des bewährten PCR-Tests ist, dass er als ressourcenaufwändig gilt und viel Zeit verschlingt: Medizinisches Personal muss sich mit Mundschutz und Handschuhen ausrüsten, ehe es einen Abstrich aus dem Mund-Nasen- oder Rachenraum von Patienten nehmen kann. Für die anschließende Auswertung braucht es chemische Substanzen und ein Labor, das ein PCR-Gerät besitzt. Das zieht oft längere Transportwege für das Probenmaterial nach sich. Müssen viele Menschen in kurzer Zeit getestet werden, vergehen mitunter Tage, bis das Testergebnis vorliegt.
Abhilfe sollte hier ein Schnelltest schaffen, den Bosch bereits Ende März vorstellte und damit ein gewaltiges Medienecho auslöste. Das Gerät besitze in etwa die Größe einer Kaffeemaschine und könne auch in Arztpraxen betrieben werden, hieß es in einer Pressemitteilung. Ein Vorteil sei, dass "direkt vor Ort" getestet werden könne, Transportwege entfielen. Doch wie sich herausstellte, waren die Testkartuschen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zugelassen. Ein weiteres Problem war die Test-Kapazität. Bosch gab an, ein einzelnes Gerät könne innerhalb von 24 Stunden bis zu zehn Proben auswerten - zu wenig für eine Anwendung in der "breiten Masse", urteilte ein Experte.
Auch die Universität Bielefeld forscht zu optimierten Testmethoden und will gängige Verfahren beschleunigen. Nach eigenen Angaben haben sie eine Methode entwickelt, die zehnmal schneller zum Testergebnis führt als ein herkömmlicher Test. Herzstück der Methode ist ein optimiertes PCR-Gerät eines niederländischen Unternehmens, in dem die für das Testergebnis notwendigen chemischen Prozesse schneller ablaufen sollen. Statt der bisher üblichen mehr als zwei Stunden, dauere der Test mit dem Gerät nur rund 16 Minuten, heißt es in einer Mitteilung. Das klingt zunächst vielversprechend, doch dazu kommt noch die Zeit für die Probenentnahme, die Aufbereitung des Materials und die anschließende Auswertung. All das dürfte ähnlich aufwendig ausfallen wie bei den aktuellen PCR-Tests. Die Studie wurde zudem noch nicht von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet.
Speichel als Forschungsansatz
Forscher der Columbia University verfolgen dagegen einen anderen Ansatz: Sie wollen den Erreger mithilfe der Spucke von Patienten nachweisen. Wer sich testen lassen will, muss dafür lediglich eine kleine Tube mit Speichel füllen. Im Anschluss kommt die Flüssigkeit in ein Röhrchen mit Enzymen und Reagenzien und wird erhitzt. Nach etwa 30 Minuten bei 63 Grad Celsius färbt sich der Inhalt des Röhrchens gelb, wenn Virus-Erbgut vorhanden ist.
Anders als bei herkömmlichen PCR-Tests bräuchte es dafür kein kostspieliges Gerät, Thermocycler genannt, heißt es in einer Mitteilung der Universität. Ein simples Wasserbad sei ausreichend, um das Material zu erhitzen. Auch der oft als unangenehm empfundene Abstrich entfällt.
Erste Tests mit der Methode zeigen vielversprechende Ergebnisse: Bei 60 Proben, die bereits vorab mit dem Goldstandard PCR getestet worden waren, lag der Speicheltest einmal daneben - er hatte einen Coronavirus-Infizierten nicht korrekt als solchen erkannt. Die Wissenschaftler geben daher den Anteil falsch-negativer Ergebnisse mit unter fünf Prozent an. Nach Angaben der Universität soll der Speicheltest auch bei sehr geringen Virusmengen anschlagen. Die Stichprobe war jedoch vergleichsweise klein. Das Ergebnis müsste noch mit größeren Tests bestätigt werden.
Sensitivität und Spezifität
Fakt ist: Gute Testmethoden sind schwer zu entwickeln. Sie müssen mit einer einfachen Anwendung punkten und sollen gleichzeitig exakte Ergebnisse liefern. Wissenschaftler unterscheiden dabei zwei Messgrößen: Die Sensitivität eines Tests gibt an, wie viele infizierte Patienten richtigerweise als krank identifiziert werden. Die Spezifität gibt an, zu wie viel Prozent ein Test tatsächlich Gesunde auch als gesund erkennt. Sie liefert damit Infos, wie viele Patienten fälschlicherweise als krank eingestuft werden.
Aus infektiologischer Sicht ist vor allem eine schlechte Sensitivität problematisch - wird ein Erkrankter nicht korrekt als solcher erkannt, kann er unbewusst weitere Menschen mit dem Erreger anstecken. Ein Coronatest aus dem Hause Abbott, der auch vom Weißen Haus benutzt wurde, war deshalb zuletzt in Kritik geraten. Nach Informationen von CNN gebe es Meldungen darüber, dass das kleine portable Gerät Corona-Infizierte nicht richtig also solche erkannt habe und somit falsch-negative Ergebnisse liefern könnte. Abbott widersprach dem und verwies auf Studien, die exakte Testergebnisse nahelegen.
Im Kampf gegen die Pandemie wären portable Tests oder mobile Testgeräte, die exakte Ergebnisse vor Ort innerhalb kurzer Zeit liefern, tatsächlich ein großer Gewinn. Das Personal von Krankenhäusern könnte damit regelmäßig getestet werden, ebenso wie Patienten, die in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim aufgenommen werden. Sinnvoll wäre ein Einsatz überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Wirksame Tests könnten so auch ein Stück weit Normalität in den Alltag einkehren lassen.
Viele ressourcenschonende Ansätze befinden sich jedoch noch in den Kinderschuhen - bis zur Marktreife dürften noch viele Monate vergehen. Bis dahin heißt es: testen, testen, testen - und zwar mit den Methoden, die derzeit zur Verfügung stehen.
Auch wenn das dem ein oder anderen Politiker nicht gefallen dürfte.
Quellen:Universität Bielefeld / University Columbia / CNN